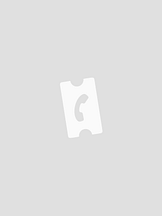Kein anderer Regisseur muss im Netz ein solch konstantes Trommelfeuer von Negativ-Kritiken ertragen wie Uwe Boll. Seitdem der deutsche Regisseur und Produzent 2003 mit seiner Videospiel-Verfilmung „House of the Dead“ erstmals auch international Aufmerksamkeit erregte, prügeln Filmfans und professionelle Kritiker auf ihn ein, dass die Tasten glühen. Handwerkliches Unvermögen und eine extrem zynische Weltsicht, so lauten die Hauptanklagepunkte. Boll selbst ätzt in Interviews und Audio-Kommentaren gnadenlos zurück. Er wirft seinen Häschern vor, eine undifferenzierte Demontierungs-Kampagne zu verfolgen. Boll selbst sieht sich sowohl als Genre-Gegisseur wie mutiger filmischer Aufklärer, der mit Filmen wie „Heart of America“ oder „Darfur“ aufrüttelndes, sozialkritisches Kino macht. Hat hier jemand seinen Realitäts-Sinn verloren? Will Boll ein Satiriker sein? Oder ist die Kritik an ihm tatsächlich manchmal nur ein Reflex? Eines steht fest: Über mangelnde Aufmerksamkeit kann Boll sich nicht beklagen.
Gestatten, Dr. Uwe Boll
„Wenn du Arschloch noch einmal die Maske abreißt, haue ich dir auf die Fresse.“ Das hätte Uwe Boll nach eigenem Bekunden zu Jim Carrey gesagt, hätte der Trash-Regisseur anstelle von Ron Howard mit dem Problem zu kämpfen gehabt, dass der Haupt-Darsteller von „Der Grinch“ jeden Abend am Set seine 6000-Dollar-Maske kaputt machte. Man ist geneigt, ihm das aufs Wort zu glauben! Dabei begann Bolls Film-Karriere ganz brav. 1965 im rheinisch-bergischen Kreis geboren, studierte er Film-Regie, Betriebswirtschaft sowie Literaturwissenschaft und bekam für seine Dissertation „Die Gattung Serie und ihre Genres“ den Doktortitel verliehen. Anstatt aber eine Akademiker-Karriere zu starten, arbeitete Boll seit den 90er Jahren als Regisseur und Produzent. Er schrieb, inszenierte und produzierte mit wenig Geld „German Fried Movie“, „Barschel – Mord in Genf“, „Amoklauf“ und „Das erste Semester“. Doch egal ob Satire, Thriller, Horror oder Komödie, die Verrisse waren ihm gewiss.
Geldmacherei
2002 war Uwe Boll der erste US-Kinostart vergönnt. Sein Mystery-Thriller „Blackwoods“ lief aber nur auf wenigen Leinwänden. Nachdem er sich danach in „Heart of America“ wieder mit dem Thema Amoklauf beschäftigt hatte, legte er 2003 seine erste Videospiel-Verfilmung vor. Der Zombie-Slasher „House of the Dead“ geriet zum Startschuss einer Reihe weiterer Adaptionen populärer Computerspiel-Erfolge: „Alone in the Dark“, „BloodRayne“, „Schwerter des Königs“, „Postal“ und schließlich „Far Cry“ mit Til Schweiger in der Hauptrolle. Die Anhänger der jeweiligen Vorlagen gaben sich weitestgehend unzufrieden mit Bolls Umsetzungen, aber finanziell lohnenswert waren diese trotzdem. Mochten sie auch im Kino floppen, spätestens die Auswertung auf DVD bzw. Blu-ray warf genügend Gewinn ab. Zumal Boll, der als Geldbeschaffer und Regisseur alle Verwertungs- und Produktions-Zügel fest im Griff hat und stets für wenig Geld dreht. Meist tut er das im günstigen Kanada – und ab 2000 nutzte er dafür eine deutsche Gesetzeslücke aus. Er bezahlte seine Filme über einen eigenen Medienfonds, der die Steuerlast seiner Anleger minderte. Die Bundesregierung stopfte aber 2005 legislativ dieses Steuer-Schlupfloch, das zahlreiche internationale Film-Produktionen über die Jahre nutzten. Boll hinderte das jedoch nicht daran, weiterhin prominente Darsteller wie Udo Kier oder Ben Kingsley für vergleichsweise geringe Summen zu verpflichten. Das Geheimnis dahinter ist schlicht, denn als Produzent nutzt Boll die Lücken in den Terminkalendern der Schauspieler und kann kurzfristige Anfragen stellen.
Ein Boxer schlägt zurück
Geschäftssinn gestehen Uwe Boll wohl selbst seine härtesten Kritiker zu. Den verbalen Angriffen im Internet tat dies aber keinen Abbruch. Der Attackierte wehrte sich 2006 mit einer PR-Aktion, die unverkennbar seine Handschrift trug. Er stellte sich einigen seiner Internet-Kritiker im Boxring. Wegen seiner eigenen Erfahrung als Boxer hatte er dabei aber leichtes Spiel mit seinen Gegnern. Für Boll sieht die Sache einfach aus: Seine Kritiker verfolgen eine Agenda, die ihm maximalen Schaden zufügen soll. Mit diesem Deutungs-Muster versucht er sich die Kritik vom Leib zu halten, die von allen Seiten auf ihn einprasselt. Im April 2008 etwa wurde eine Online-Petition gestartet, die Boll dazu aufruft, das Filmemachen bleiben zu lassen. Und 2009 verpassten ihm die Juroren der „Goldenen Himbeere“ den Titel „Deutschlands Antwort auf Ed Wood“ für das schlechteste (bisherige) Lebenswerk. Als Reaktion auf die Petition bezeichnete er sich in einer Videobotschaft als „einziges Genie im Filmbusiness“. Die Himbeere wiederum nahm er zum Anlass, der Jury seinen Dank auszusprechen, weil die sein Leben zerstört habe und er nun in Darfur wohnen müsse. Das sei aber gar nicht so schlimm, da es sich dort aufgrund der vielen Spenden von George Clooney und Matt Damon sowieso besser leben lasse als in New York. Soviel ist sicher: Uwe Boll mag die Rolle des sarkastischen Underdogs.
Auf zu neuen Ufern?
Was 2007 bereits absehbar war, fand in den anschließenden Jahren Bestätigung: Uwe Boll mauserte sich endgültig zum Vielfilmer. Abgesehen von Ausschuss-Ware wie der vollkommen verunglückten Nazi-Komödie „Blubberella“, der nicht mal Boll selbst etwas abgewinnen kann, wurde auch die Ambition sichtbar, politisch oder historisch relevante Stoffe anzupacken. „Tunnel Rats“ spielt im Vietnam-Krieg, „Rampage“ kreist wieder um die Thematik „Amoklauf“ und „Auschwitz“ widmet sich dem Holocaust. Die Umorientierung wurde von einem Kritiker-Echo begleitet, das in sensiblen Ohren etwas weniger vernichtend klingt als früher. „Darfur“ gewann 2010 sogar den Preis als bester Film des „International Independent Film and Video Festival“ in New York. Ob das die ersten Anzeichen einer qualitativen Trendwende sind, bleibt freilich abzuwarten.